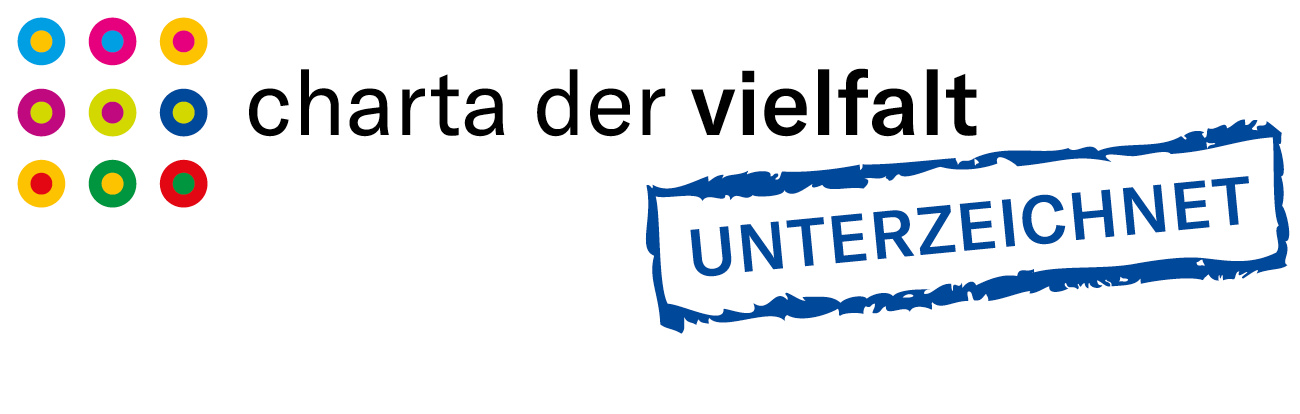Dekubitus Definition
Was ist ein Dekubitus bzw. Druckgeschwür? Hierbei handelt es sich um eine schmerzhafte Schädigung der Haut, die durch sogenanntes “Wundliegen”, also anhaltenden Druck auf die Haut oder Reibung entsteht.
Dieser schädigt beim Liegen nicht nur die Hautoberfläche, sondern beeinträchtigt auch die Durchblutung. So wird betroffenes Gewebe nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, was schließlich zum offenen Hautdefekt führen kann. Dieser Defekt kann so stark sein, dass er sich von der Hautoberfläche bis hinunter zum Knochen erstreckt. Der Heilungsprozess erfordert Wochen oder sogar Monate, wobei auch nach der Abheilung dauerhafte Schäden zurückbleiben können.
Dekubitus Symptome
Da sich ein Dekubitus schleichend entwickelt, bleiben erste Anzeichen oftmals subtil. Damit Sie schnell handeln können, informieren wir hier über die Symptome.
Anhaltende Röte, die auch bei Druckbelastung nicht verschwindet, kann als typisches Warnsignal verstanden werden. Des Weiteren signalisieren Schwellungen, Veränderungen der Hauttemperatur (sowohl wärmere, als auch kältere Haut) der umliegenden Stelle, Blasenbildung und auch bereits offene Wunden sind als klare Zeichen zu interpretieren und erfordern rasches Handeln. Beobachten Sie eines dieser Symptome, ist es entscheidend, eine Pflegefachkraft zu informieren. Mit einer qualifizierten Einschätzung ist über den Handlungsbedarf und Dekubitusprophylaxe Maßnahmen zu entscheiden, um die Entstehung zu vermeiden.
Wer ist anfällig für Dekubitus?
Risikofaktoren, die Dekubitus begünstigen sind:
- Eingeschränkte Mobilität (jedes Alter)
- Erhöhtes Lebensalter
- Über- oder Untergewicht
- Inkontinenz
- Scherkräfte
- Falsche Lagerung bzw. Positionierung
Abweichend von der professionellen Pflege-dokumentation
Dekubitus-Diagnose: So wird ein Druckgeschwür erkannt
Ein fortgeschrittener Dekubitus lässt sich in der Regel deutlich erkennen: Die betroffenen Hautstellen sind sichtbar geschädigt, häufig treten Entzündungen, Schwellungen oder offene Wunden auf. Auch Schmerzen an den gefährdeten Körperstellen sind typische Anzeichen. Doch schon frühe Symptome wie anhaltende Rötungen, eine ungewöhnliche Empfindlichkeit oder ein Druckgefühl sollten ernst genommen werden. Eine frühzeitige Abklärung durch medizinisches Fachpersonal ist entscheidend, um eine Verschlechterung zu verhindern. Als erste Ansprechpartner eignen sich Hausärzte oder Dermatologinnen und Dermatologen. Auch Pflegekräfte können auffällige Veränderungen erkennen, doch die gesicherte Diagnose sollte immer ärztlich gestellt werden.
Die Diagnostik beginnt in der Regel mit einem ausführlichen Gespräch, in dem der gesundheitliche Gesamtzustand der betroffenen Person betrachtet wird. Dabei spielen bestehende Vorerkrankungen, die körperliche Beweglichkeit, der Ernährungszustand, mögliche Schmerzen oder die Einnahme bestimmter Medikamente eine Rolle. Anschließend folgt eine sorgfältige körperliche Untersuchung. Dabei werden vor allem jene Stellen des Körpers begutachtet, die für die Entstehung der Krankheit besonders anfällig sind. Der Zustand der Haut, das Aussehen einer möglichen Wunde und deren Lage sowie Größe und Tiefe geben wichtige Hinweise auf das Vorliegen eines Druckgeschwürs.
Wenn sich der Verdacht bestätigt, erfolgt eine medizinische Einordnung in ein Schweregrad-System. Es gibt vier sogenannte Dekubitus-Kategorien (Dekubitus Grade) – von einer oberflächlichen Rötung ohne Gewebeverlust bis hin zu tiefen, offenen Wunden, die bis auf Muskeln oder Knochen reichen können. Hinweis für pflegende Angehörige: Das Druckgeschwür kann je nach Schwere Einfluss auf den zugeordneten Pflegegrad nehmen.
Bei fortgeschrittenen Wunden mit sichtbaren Entzündungen oder eitrigem Belag kann zusätzlich ein Wundabstrich durchgeführt werden. Dadurch lässt sich feststellen, ob eine bakterielle Infektion vorliegt und welche Erreger beteiligt sind. In manchen Fällen wird auch Blut abgenommen, um Hinweise auf eine systemische Entzündungsreaktion zu erhalten. Besteht der Verdacht, dass das Geschwür bereits tiefere Gewebeschichten oder sogar Knochenstrukturen erreicht hat, können bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen notwendig sein.
Eine frühzeitige Diagnose ist besonders wichtig, da sie nicht nur über die geeigneten Behandlungsschritte entscheidet, sondern auch entscheidend zur Vermeidung von Komplikationen beiträgt. Wer Veränderungen an der Haut bemerkt oder bei sich oder Angehörigen unsicher ist, sollte nicht zögern, eine medizinische Abklärung einzuleiten.
Vorbeugende Maßnahmen: Wie können Sie den Dekubitus-Selbsttest (Fingertest) durchführen?
Welche Körperstellen sind anfällig für ein Dekubitus?
Besonders anfällig für die Entstehung sind Körperstellen, die direktem Kontakt zur Unterlage ausgesetzt sind oder, weil Knochen direkt unter der Haut liegen, wodurch sich der Druck auf das Gewebe erhöht, und die Durchblutung erschwert wird.
Hierzu zählen:
- Kreuz- und Steißbein, weil dieser Bereich viel Gewicht beim Liegen und Sitzen trägt
- Hüften, weil in Seitenlage ein erheblicher Teil des Körpergewichts auf ihnen lastet
- Schulterblätter, weil besonders bei untergewichtigen Personen die Belastung auf der Haut durch die Knochen groß ist
- Fersen, weil der Muskel- und Fettgebeanteil gering ist und der Knochen dicht unter dem Gewebe liegt
- Hinterkopf, da eine langanhaltende Rückenlage für wenig, bis keine Entlastung sorgt
Gesunde Personen reagieren reflexartig auf das Druckgefühl, mit dem der Körper Überlastung signalisiert und passen ihre Liegeposition an. Motorisch eingeschränkte Personen können diesem Gefühl nicht entgegenwirken und die Positionskorrektur nicht eigenständig ausführen.
Hautpflege & Ernährung:
- Tägliche Kontrolle gefährdeter Hautpartien
- Reinigung mit pH-neutralen, rückfettenden und duftfreien Produkten, ohne starke Reibung
- Wirksam bei dünner Haut, Inkontinenz oder trockener Haut
- Atmungsaktive, nicht einschnürende Kleidung
- Regelmäßiger Wechsel von Inkontinenzmaterial
- Nährstoffreiche, ausgewogene Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr – besonders bei Mangelernährung ggf. Trinknahrung einsetzen
Positionswechsel & Lagerung:
- Rotationsintervall: alle 2–4 Stunden (je nach Risiko) Umlagerung zur Druckentlastung
- Freilagerung und Abpolsterung von Knochenspitzen mit Hilfsmitteln
- Glattziehen von Laken, Vermeidung schlechter Faltenbildung oder Druck durch Sonden, Kabel etc.
Dekubitus vorbeugen
Damit ein Dekubitus gar nicht erst entsteht, haben wir Ihnen eine Übersicht über Positionierungen zur Druckentlastung zusammengestellt. Bestenfalls leitet Sie bei der Durchführung eine ausgebildete Pflegefachkraft an, um eine falsche Durchführung zu vermeiden.
Mikrolagerung
Ideal für Patienten, die sich nicht selbstständig bewegen können oder auch für Schmerzpatienten, ist die Mikrolagerung. Durch schnelle, sanfte und minimale Bewegungen können Änderungen der Lagerung vorgenommen werden. Alle 30 Minuten werden hierbei kleine Anpassungen der Positionierung durchgeführt: Etwa kleine Druckverlagerungen an Kopf, Schultern, Hüfte und Fersen. Das Drehen von der linken auf die rechte Seite z. B. stellt solch eine Mikrolagerungsveränderung dar. Beachten Sie hierbei auch die Verschiebung von Gelenken, da auch ein geringer Unterschied zur prophylaktischen Wirkung beiträgt.
Hinweis: Personen im Rollstuhl können ebenfalls ein Dekubitus entwickeln und sind von der Prophylaxe nicht ausgenommen.
30 Grad-Lagerung

Eine bewährte Methode zur Druckentlastung ist die sogenannte Schräglage “30 Grad-Lagerung”. Der Körper wird hierbei in eine seitliche Position (Schräglage von 30 Grad) gebracht und gelagert. Die Technik soll den Druck auf Kreuzbein und Hüften reduzieren, indem das Körpergewicht auf gepolstertere Gewebestellen verteilt wird. Wir empfehlen, diese Position alle drei bis vier Stunden zu wechseln.
135 Grad-Lagerung

Die 135 Grad-Lagerung kann besonders solche Personen entlasten, die bereits ein Dekubitus aufweisen. Legen Sie – mit dem Bauch nach unten liegend – ein Kissen unter die Hälfte des Oberkörpers und weiteres unter die Hüfte und das obere Bein.
Lagerungshilfsmittel für die Dekubitusprophylaxe
Falttechniken zur Mikrolagerung sind:
- 3-fach Faltung: Zur Lagerung des Schulterblatts oder des Gesäßes
- Rolle: Ideal zur Positionierung unter den Kniekehlen
- Brezel-Faltung: Für die Lagerung der Extremitäten oder Fersen-Positionierung. Hierbei unbedingt auch ein Kissen in die Kniekehlen legen!