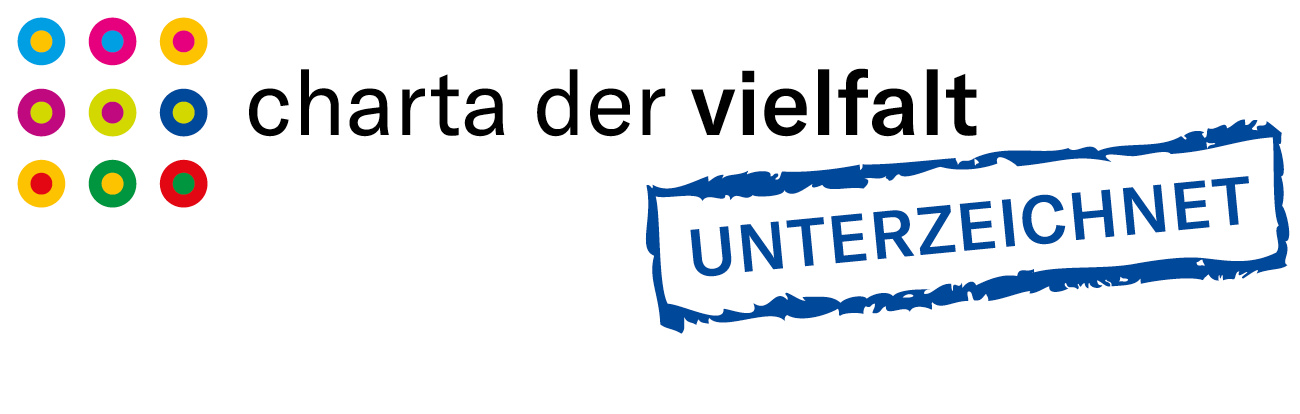Expertenbeitrag zum Thema Diabetes
Sicherer Umgang mit Diabetes in der Pflege – Expertenbeitrag

Frau Landwehr
Diabetesassistentin, med. tech. Laboratoriumsassistentin

Marc Heßling: Wund- & Qualitätsmanager, Krankenpfleger,
Praxisanleiter
Marc Heßling:
Liebe Frau Landwehr, wie sind Sie zur Diabetologie gekommen und was fasziniert Sie an diesem Fachbereich besonders?
Frau Landwehr:
Ich habe med.-techn. Laboratoriumsassistentin gelernt und insgesamt 20 Jahre im Elisabeth Krankenhaus in Essen gearbeitet. Im Rahmen meines Erziehungsurlaubes bin ich auf der Suche nach einem Minijob in der Diabetologie des Elisabeth Krankenhauses gelandet.
Diese Tätigkeit hat mir so gut gefallen, dass ich 2002 eine Zusatzausbildung zur Diabetesassistentin gemacht habe.
Der Umgang mit Menschen macht mir viel Freude und mir ist es wichtig, Ihnen zu helfen, Sie zu unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Das Thema „Diabetes“ gewinnt immer mehr Beachtung, in Deutschland gibt es mittlerweile ca. 9 Millionen Diabetiker mit Typ 2 und ca. 370.000 Diabetiker mit Typ 1.
“Man schätzt die Dunkelziffer von Diabetikern auf ca. 2 Millionen!”
Marc Heßling:
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Missverständnisse, die Menschen über Diabetes haben?
Frau Landwehr:
Ich würde sagen, dass die häufigsten Missverständnisse in Bezug auf Ernährung bestehen. Das Wissen über gute Ernährung ist bei den meisten Betroffenen eher schlecht als recht.
Marc Heßling:
Wie entsteht Diabetes?
Frau Landwehr:
Da muss man erst einmal die verschiedenen Formen des Diabetes unterscheiden.
Typ 1 Diabetes
ist eine Autoimmunerkrankung und kann schon im Kleinkindalter auftreten. Das körpereigenen Immunsystem richtet sich gegen die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Es gibt bestimmte Gene, die eine solche Erkrankung begünstigen, bei diesem Typ Diabetes ist eine Insulintherapie unumgänglich.
Typ 2 Diabetes:
diese Form des Diabetes tritt häufiger bei Menschen mit Übergewicht und einem schlechten Lebensstil (zucker- und fettreiche Ernährung, Bewegungsmangel) auf. Auch eine erbliche Disposition und zunehmendes Alter spielen eine Rolle.
Diabetes Typ LADA:
Diese Erkrankung ist mit einem Typ 1 Diabetes gleichzusetzen, nur mit dem Unterschied, dass diese Erkrankung erst im höheren Lebensalter (40-60 Jahren) auftritt. Die Ursache für die Verschiebung ist nicht geklärt, aber auch dort wird vermutet, dass es genetisch bedingt ist. Auch Umwelteinflüsse können eine Rolle spielen. Diese Erkrankung wird häufig mit einem Typ 2 Diabetes verwechselt, da sie sich über einen längeren Zeitraum entwickelt.
Diabetes Typ MODY:
Dabei handelt es sich um eine Genmutation, die vererbt wird. Die Erkrankung tritt im jungen Erwachsenenalter auf und ist ein sogenannter Insulinmangeldiabetes. Die Diagnose kann nur durch einen Gentest bestätigt werden. Die Behandlung erfolgt zunächst mit Tabletten, wird aber langfristig in eine Insulinpflicht führen.
Gestationsdiabetes:
Hierbei handelt es sich um einen Diabetes, welcher in der Schwangerschaft auftritt, es kommt zu einer Störung des Blutzuckerstoffwechsels.
Marc Heßling:
Was sind die typischen Frühsymptome – und wann sollten Angehörige darüber nachdenken, einen Test zu veranlassen?
Frau Landwehr:
Häufig klagen die Patienten über Müdigkeit und Erschöpfung. Dazu kommen Symptome wie:
- häufiges Wasser lassen, auch nachts
- vermehrter Durst und Mundtrockenheit
- verschwommenes Sehen
- trockene, juckende und entzündete Haut
- schlecht heilende Wunden
Über den Alltag mit Diabetes
Marc Heßling:
Welche täglichen Herausforderungen erleben Menschen mit Diabetes im Alltag – insbesondere ältere Betroffene?
Frau Landwehr:
Wenn Patienten insulinpflichtig sind, müssen Sie auf regelmäßige Nahrungszufuhr achten, Symptome einer Unterzuckerung erkennen. Auch sind Sie eingeschränkt, da eine regelmäßige Blutzuckermessung und das Spritzen von Insulin vor einer Mahlzeit dringend erforderlich sind.
Alle Diabetiker müssen auf eine zuckerarme und kohlenhydratmodifizierte Ernährung achten.
Marc Heßling:
Welche Untersuchungen dienen zur Diagnose und wie oft sollten Kontrollwerte überprüft werden?
Frau Landwehr:
Wichtig ist vor allem, Diabetes in einem sehr frühen Stadium zu diagnostizieren. Die meisten Patienten sind in dieser Phase symptomlos.
Als erstes empfiehlt sich ein sog. oraler Glucosetoleranztest, mit welchem ein sehr frühes Stadium der Diabeteserkrankung diagnostiziert werden kann. Ist dieser auffällig, schließt man dieser Untersuchung eine Blutentnahme an. Man testet den Langzeitzucker (HbA1c) und einen Nüchternblutzucker. Ich empfehle Kontrollen in einem Zeitraum von 3 Monaten.
Marc Heßling:
Frau Landwehr, können Sie erläutern, welche Risikofaktoren pflegende Angehörige besonders beachten sollten?
Frau Landwehr:
Für pflegende Angehörige ist zu beachten, dass bei insulinpflichtigen Personen eher Unterzuckerungen auftreten können. Sie sollten diesbezüglich geschult werden, auch wie man eine Insulininjektion durchführt. Zusätzlich ist es wichtig, sich mit Ernährung auszukennen, auch wie man Broteinheiten abschätzt.
Marc Heßling:
Welche Früherkennung und Pflegemaßnahmen empfehlen Sie beim diabetischen Fuß
– etwa tägliche Kontrolle, passende Fußpflege und Schuhwerk?
Frau Landwehr:
Der Früherkennung dient eine Fußinspektion, welche der behandelnde Arzt durchführt. Bei dieser Untersuchung erkennt man Sensibilitäts- und/oder Durchblutungsstörungen. Findet man eine Störung der Sensibilität, Fußdeformationen, pathologisches Nagelwachstum oder offene Wunden, überweist man den Patienten fachgerecht entweder an eine Fußambulanz, einen Neurologen oder Gefäßchirurgen. Nur bei diesen Diagnosen kann eine podologische Fußbehandlung verordnet werden. Auch eine Anbindung an einen Diabetologen ist unbedingt notwendig.
Marc Heßling:
Welche Rolle spielt Ernährung im Krankheitsverlauf und was sind einfache Tipps für den Alltag?
Frau Landwehr:
“Ernährung spielt eine große Rolle, ich würde sagen, neben der Therapie, die wichtigste!”
An allererster Stelle ist eine zuckerarme Ernährung wichtig. Kohlenhydrate wie Brot (vor allem Weißmehlprodukte), Nudeln, Reis und Kartoffeln sollten nicht in großen Mengen gegessen werden, Obst idealerweise zum Frühstück und zum Mittagessen.
Tierische Produkte sollten mager sein, dadurch einen steigenden Anteil von Eiweiß aufweisen, welcher gerade bei Senioren wichtig für den Erhalt der Muskulatur ist. Dazu zählen:
- Fleisch / Fisch
- Milchprodukte
- Eier
Pflanzliches Eiweiß, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte und Soja, sind eine gute Ergänzung für Menschen, welche weniger oder gar keine tierischen Produkte essen.
Gute pflanzliche Fette sind beispielsweise Olivenöl und Rapsöl, Sie sind reich an ungesättigten Fettsäuren.
Salat und Gemüse sollten täglich auf dem Teller landen und können viel gegessen werden.
Marc Heßling:
Was gibt es bei dem Umgang mit der Insulinspritze zu beachten? Wie und wann kommt sie zum Einsatz?
Frau Landwehr:
Insulin kommt zum Einsatz, wenn eine Therapie mit Medikamenten allein nicht mehr ausreicht, um den Blutzucker zu senken.
Beim Spritzen ist darauf zu achten, dass vor jeder Injektion die Nadel gewechselt wird. Nach der Injektion wartet man ca. 10 Sekunden, bevor die Nadel wieder herausgezogen wird – so vermeidet man, dass an der Einstichstelle Insulin austritt. Die Nadellänge kann zwischen 4 – 12 mm variieren. Früher hat man für besonders adipöse Patienten lange Nadeln verwendet. Heute weiß man, dass auch kurze Nadeln ausreichen, sodass die Standardlänge mittlerweile zwischen 4 – 6 mm beträgt. Besonders wichtig ist ein systematischer Spritzstellenwechsel, dieser verhindert, dass sich Spritzstellenveränderungen, sog. Lipohypertrophien bilden. Auch das sollte der behandelnde Arzt regelmäßig kontrollieren!
Marc Heßling:
Es gibt besondere Phänomene wie das Dawn-Phänomen oder das Somogyi- Effekt – Wie geht man damit im Praxisalltag um?
Frau Landwehr:
In beiden Fällen handelt es sich um Nüchternblutzucker Anstiege.
Das Dawn-Phänomen entsteht durch eine erhöhte Ausschüttung von Hormonen, welche Gegenspieler zum Insulin sind. Sie begünstigen auch die Freisetzung von Zucker aus der Leber. Man kann dem entgegenwirken, indem der Patient abends keine großen Mengen an Kohlenhydraten isst. Zusätzlich ist häufig der Einsatz von Insulin notwendig, welches in der Nacht die Bauchspeicheldrüse unterstützt.
Beim Somogyi-Effekt entsteht eine nächtliche Unterzuckerung bei insulinbehandelten Patienten. Diese sorgt für eine Gegenregulation, die Leber und Muskulatur mobilisieren (aus Zuckerreserven). Das führt zu einem Blutzuckeranstieg, welcher sich durch erhöhte Nüchternblutzucker bemerkbar macht. Abhilfe schafft man durch die Reduktion des Insulins!
Medikamentöse Behandlung und Kontroll
Marc Heßling:
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es
– und nachdem ein Patient diagnostiziert wurde, wie läuft die Behandlung ab?
Frau Landwehr:
Ein Patient wird therapiebedürftig, sobald er seinen Diabetes allein durch Ernährung und Bewegung nicht mehr in den Griff bekommt. In der Regel beginnt man eine Therapie mit Tabletten, da stehen uns verschiedene Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Ist eine Therapie mit Tabletten allein nicht mehr ausreichend, ergänze ich die Therapie mit Insulin oder einem GLP 1.
Marc Heßling:
Wie differenziert man zwischen konventioneller und intensivierter Insulintherapie?
Frau Landwehr:
Wir unterscheiden 3 verschiedene Therapien mit Insulin:
BOT
ist eine basalunterstützte orale Therapie, das heißt, der Patient bekommt zu seinen Tabletten ein 24 Stunden Insulin zur Unterstützung.
CT
ist die konventionelle Therapie, dabei spritzt man eine Mischinsulin, welches Lang-und Kurzzeitinsulin enthält. Dieses Insulin spritzt man 2-mal täglich. Es ist darauf zu achten, dass der Patient regelmäßig Nahrung zu sich nimmt, da bei dieser Therapie sonst ein hohes Risiko besteht, zu unterzuckern.
ICT
ist die intensivierte Insulintherapie. Bei dieser Therapie arbeitet man mit einem Langzeit- (Basal-) Insulin und einem kurzwirksamen (Mahlzeiten-) Insulin.
Bei dieser Therapie ist der Patient in seiner Nahrungsaufnahme flexibel, es ist aber stets erforderlich, vor jeder Mahlzeit seinen Blutzucker zu messen, um je nach Wert, eine entsprechende Menge Insulin zu spritzen. Das erfordert mindestens vier Messungen täglich.
Marc Heßling:
Was sind die häufigsten Fehler bei der Insulingabe, die Sie in der Praxis sehen?
Frau Landwehr:
Die häufigsten Fehler gibt es bei der Injektion. Leider werden viel zu selten Spritzstellen gewechselt. Häufig finde ich Veränderungen, sog. Lipohypertrophien, rechts und links vom Bauchnabel. Das wird oftmals noch begünstigt durch ein zu seltenes Wechseln der Nadeln.
Marc Heßling:
Wie wichtig ist das regelmäßige Messen des Blutzuckers – und wie genau sollte das erfolgen?
Frau Landwehr:
Regelmäßige Blutzuckerkontrollen sind nur bei einer Insulintherapie erforderlich. Blutzuckerteststreifen werden auch nur dann von der Krankenkasse übernommen. Natürlich kann und darf jeder Diabetiker Blutzucker messen, es bietet sich immer dann an, wenn es dem Patienten nicht gut geht und man unsicher ist, ob das Unwohlsein vom Blutzucker kommt.
Wer ein eigenes Blutzuckermessgerät besitzt, sollte auch in regelmäßigen Abständen Kontrollen durchführen, dazu kann man eine Kontrolllösung in der Apotheke kaufen.
Ich biete meinen Patienten immer an, Ihr Blutzuckergerät mit dem meinem gegenzumessen, da wir als Praxis verpflichtet sind, regelmäßig Qualitätskontrollen durchzuführen.
Marc Heßling:
Gibt es neue Entwicklungen in der Behandlung von Diabetes, die insbesondere für ältere Menschen hilfreich sein könnten?
Frau Landwehr:
Ja, es gibt Glucose-Messsensoren, sog. CGM-Geräte. Diese messen den Blutzucker kontinuierlich im Gewebezucker, somit fällt das Stechen in den Finger weg. Die Patienten oder Angehörigen können sich jederzeit ein Bild über den aktuellen Blutzucker machen.
“Leider genehmigen die Krankenkassen diesen Sensor nur bei Patienten mit einer intensivierten Insulintherapie, leider aber auch nicht alle!”
Marc Heßling:
Welche oralen Antidiabetika gibt es – und wann kommen sie zum Einsatz?
Frau Landwehr:
Es gibt folgende Wirkstoffe:
- Biguanide (Metformin) setzen die Insulinresistenz herab, verbessern den nächtlichen Blutzuckerverlauf, indem die Zuckerproduktion in der Leber gehemmt wird.
- DPP4 Hemmer (z.B. Sitagliptin) stabilisiert das Hormon GLP1, welches für die Regulierung des Blutzuckers mit verantwortlich ist.
- SGLT2 Hemmer (z.B. Jardiance) sorgen dafür, dass weniger Zucker ins Blut aufgenommen wird, stattdessen wird er über den Urin ausgeschieden.
- Nicht-Sulfonylharnstoffe (Repaglinide) regen die Bauchspeicheldrüse an, mehr Insulin zu produzieren – sie wirken schnell und kurz.
- Sulfonylharnstoffe (z.B. Glibenclamid) regen ebenfalls die Bauchspeicheldrüse an, wirken nur deutlich länger, somit steigt die Gefahr einer Unterzuckerung.
Pflege und Notfallsituationen
Marc Heßling:
Welche Spätkomplikationen treten häufig auf – und wie können Pflegekräfte präventiv eingreifen?
Frau Landwehr:
Häufige Spätkomplikationen bei Diabetikern sind Schäden an den Nieren (Nephropathie), dem Auge (Retinopathie) und den Nerven (Polyneuropathie), sog. Mikroangiopathien (Schäden an kleinen Gefäßen).
Durchblutungsstörungen in den Beinen (pAVK), Herzinfarkte oder Schlaganfälle, sog. Makroangiopathien.
Die einzige Möglichkeit, Folgeschäden zu vermeiden, stellt neben einer guten Blutzuckereinstellung, ein guter Lebensstil und, wenn möglich, regelmäßige Bewegung dar. Außerdem sollte man versuchen, Übergewicht in den Griff zu bekommen.
Pflegekräfte sollten den behandelnden Arzt, wenn kontinuierlich zu hohe Blutzucker gemessen werden, darauf aufmerksam machen.
Marc Heßling:
Woran erkennt man eine drohende Unter- oder Überzuckerung, und wie sollte man reagieren?
Frau Landwehr:
Symptome einer Überzuckerung (Hyperglykämie) sind:
- verschwommenes Sehen
- Durst / Mundtrockenheit
- vermehrtes Wasser lassen
- Müdigkeit
- Übelkeit
Bei sehr hohen Blutzuckerwerten kann es zu einer Bewusstseinsstörung kommen, bis hin zum hyperglykämischen Koma.
Bitte informieren Sie einen Arzt über zu hohe Blutzuckerwerte, im Notfall rufen Sie einen Rettungsdienst!
Symptome einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) sind:
- Zittern
- Schweißausbruch
- Unkonzentriertheit, Verwirrtheit
- Kopfschmerzen
- Aggressivität
Bei sehr niedrigen Werten (< 60 mg/dl) soll der Patient Zucker zuführen, in Form von gezuckerter Limonade, Fruchtsaft oder Traubenzucker. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer Bewusstlosigkeit kommen, in diesem Fall rufen Sie den Rettungsdienst an. Wenn verfügbar, benutzen Sie eine Glucagon Spritze (Hypo Kit), mittlerweile gibt es auch ein Nasenspray zur Notfallbehandlung (Baqsimi).
Marc Heßling:
Wie erkennt man eine gefährliche Stoffwechselentgleisung wie Ketoazidose oder hyperosmolares Koma bei Diabetes?
…und was müssen Pflegekräfte dann tun?
Frau Landwehr:
Ist der Patient komatös, behandeln Sie Ihn wie bereits erwähnt, rufen aber bitte als erstes den Rettungsdienst.
Ist der Patient ketoazidotisch, muss er auf jeden Fall stationär behandelt werden. Das ist ein Hinweis auf einen Blutzuckerentgleisung mit Übersäuerung, unbehandelt führt dieser Zustand im schlimmsten Fall in ein Koma.
Marc Heßling:
Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit Hausärzten und Pflegekräften bei der Betreuung Ihrer Patient:innen?
Frau Landwehr:
Ohne die Kooperation mit einem Arzt wäre meine Tätigkeit nicht möglich. Ich schätze die Kooperation mit einem Pflegedienst, leider ist das nicht die Realität. Es wäre wünschenswert, wenn die Zusammenarbeit mit Pflegediensten besser funktionieren würde. Aber ich glaube, dass es große Defizite bezüglich Diabetes gibt und ich würde mich sehr freuen, daran zu arbeiten, dass es in Zukunft besser funktioniert.
Psyche und Lebensqualität
Marc Heßling:
Wie beeinflusst Diabetes die Psyche von Patient:innen?
– gerade bei Menschen, die auch pflegebedürftig sind?
Frau Landwehr:
Leider ist das Risiko als Diabetiker pflegebedürftig zu werden größer als bei anderen Patientengruppen.
Häufig entstehen Ängste vor Folgeerkrankungen oder einer Unterzuckerung, gerade wenn man auf Fremdhilfe angewiesen ist. Es können auch vermehrt Depressionen auftreten, welche nicht außer Acht gelassen werden sollten. Auch da gibt es unterschiedliche Hilfen und Therapieansätze. In jedem Fall sollen die Patienten das beim Hausarzt ansprechen.
Marc Heßling:
Wir glauben daran, dass ein aktives Leben mit Diabetes möglich ist – auch im hohen Alter oder bei Pflegebedarf. Deshalb setzen wir auf:
- individuelle Betreuung mit Schwerpunkt Diabetes
- aktivierende Pflege, die Beweglichkeit und Eigenständigkeit erhält
- motivierende Unterstützung im Alltag, statt Übernahme von allem
- enge Zusammenarbeit mit Angehörigen, Hausärzten und Diabetologen
So helfen wir unseren Klient:innen, ihre Erkrankung zu verstehen, im Griff zu behalten und trotz Pflegebedürftigkeit möglichst selbstbestimmt zu leben.
“Frau Landwehr, was kann man noch tun, um trotz Diabetes ein möglichst selbstbestimmtes und aktives Leben zu führen?”
Frau Landwehr:
Ein Diabetiker kann mit den uns zu Verfügung stehenden Therapien ein sorgenfreies und aktives Leben führen.
Wer regelmäßig den Kontakt zum Hausarzt und zu mir sucht, wird sicherlich optimal eingestellt und betreut werden. Ich stehe meinen Patienten jederzeit für Fragen oder Sorgen zur Verfügung – Gerade im Bereich Ernährungsoptimierung, Gewichtsreduktion und Nahrungsergänzung.
Auch um Therapieziele zu erreichen ist es unumgänglich, regelmäßig Kontakt zu halten.
Marc Heßling:
Welche Rolle spielen Ernährung und Bewegung?
– insbesondere im Alter – und welche einfachen Empfehlungen gibt es?
Frau Landwehr:
Ernährung und Bewegung sind das „A und O“ in der Diabetestherapie.”
Um eine Ernährungsempfehlung in kurze Worte zu fassen, empfehle ich eine mediterrane Ernährung. Wichtig ist eine angepasste Eiweißzufuhr, um seine Muskulatur zu erhalten. Obst, Gemüse und Salat sollen in der täglichen Ernährung nicht fehlen. Süßigkeiten und Zucker sollen wenig gegessen werden.
Komorbiditäten und Begleiterkrankungen
Marc Heßling:
Welche Begleiterkrankungen treten bei Diabetes besonders häufig auf?
– und was bedeutet das für die Pflege und Betreuung der Betroffenen?
Frau Landwehr:
Häufig treten Polyneuropathien und Durchblutungsstörungen auf, daraus resultieren Wundheilungsstörungen. Diese infizieren sich sehr häufig, sodass ein großer Aufwand betrieben werden muss, um die Wunde zu versorgen. Ich empfehle eine Anbindung an einen Gefäßchirurgen und Wundmanager. Bei Verletzungen an den Füßen empfiehlt sich eine Anbindung an eine Fußambulanz. In den meisten Fällen können die Wunden so gut behandelt werden, dass Amputationen vermieden werden können. Der Chirurg ist tatsächlich die letzte Instanz, wenn eine Amputation droht.
Marc Heßling:
Wie hängen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen?
– und worauf sollten pflegende Angehörige bei betroffenen Personen achten?
Frau Landwehr:
Herz-Kreislauferkrankungen treten deutlich häufiger bei Diabetikern auf. Man sagt, ein Diabetiker hat ein genauso hohes Risiko an einem Herzinfarkt zu erkranken, wie Jemand, der schon einen Herzinfarkt hatte. Häufig leidet der Diabetiker an einer Fettstoffwechselstörung und einen Bluthochdruck, alle diese Faktoren tragen zum Infarktrisiko bei. Um das Risiko zu minimieren, steht an allererster Stelle die Erkrankungen medikamentös gut einzustellen. Auch da ist eine regelmäßige Kontrolle unbedingt erforderlich.
Marc Heßling:
Was ist bei gleichzeitiger Einnahme anderer Medikamente zu beachten, wenn eine Person an Diabetes leidet?
Frau Landwehr:
Die Medikamente, welche uns für Diabetiker zur Verfügung stehen, sind gut verträglich mit anderen Medikamenten, wie zum Beispiel Blutdrucksenker oder Cholesterinsenker.
Komplikationen und Wundheilung
Marc Heßling:
Warum verläuft die Wundheilung bei Menschen mit Diabetes oft schlechter?
– und was sind Warnzeichen für eine problematische Entwicklung?
Frau Landwehr:
In erster Linie entstehen Wundheilungsstörungen, wenn gleichzeitig eine Durchblutungsstörung besteht. Ein zusätzliches Risiko ist eine Polyneuropathie, bei diesen Patienten besteht eine Empfindungsstörung, sodass Verletzungen, zum Beispiel an Füßen, nicht bemerkt werden. Da kommen Angehörige und der Pflegedienst zum Einsatz. Ich rate bei diesen Patienten zu einer regelmäßigen Fußkontrolle auf Verletzungen.
Marc Heßling:
Wie kann man Wundinfektionen oder Druckgeschwüre bei pflegebedürftigen Diabetiker:innen möglichst verhindern?
Frau Landwehr:
“Durch regelmäßige Kontrollen!”
Marc Heßling:
Welche Rolle spielt die Durchblutung bei Diabetes?
– und wie äußert sich eine Verschlechterung etwa in den Beinen oder Füßen?
Frau Landwehr:
Natürlich ist eine gute Durchblutung wichtig. Bei Durchblutungsstörungen ist eine regelmäßige Kontrolle beim Gefäßchirurgen wichtig, auch ein regelmäßiges Lauftraining, dieses fördert die Durchblutung und senkt das Risiko einer Thrombose. Auch die Einnahme von Blutverdünnern wird empfohlen.
Jegliche Verfärbungen (rot oder blau) sind Hinweise auf eine Verschlechterung der Durchblutung. Auch Schmerzen beim Gehen oder auch Ruheschmerzen in den Beinen können ein Hinweis auf eine Verschlechterung sein.
Marc Heßling:
Was sind typische Pflegefehler bei der Wundversorgung von Diabetiker:innen?
– und wie lässt sich das vermeiden?
Frau Landwehr:
Die meisten Fehler entstehen durch unhygienische Versorgung. Man sollte stets sterile Wundauflagen benutzen, desinfizieren und Handschuhe tragen, um eine Wundinfektion zu vermeiden.
“Hygiene ist unabdingbar!”
regelmäßige Haut- und Fußkontrollen, gute Blutdruck- und Blutzuckereinstellung, spezielle Wundbeobachtung und die enge Abstimmung mit Ärzt:innen und Podolog:innen.


Abschluss und Ausblick
Marc Heßling:
Was würden Sie pflegenden Angehörigen mit auf den Weg geben, die sich unsicher fühlen?
Frau Landwehr:
Gerne biete ich ein Gespräch mit Angehörigen an, um Unsicherheiten und Bedenken aus dem Weg zu räumen. Aufklärung ist ausgesprochen wichtig.
Marc Heßling:
Gibt es Informationsquellen oder Schulungsangebote, die Sie besonders empfehlen können?
Frau Landwehr:
Es gibt Schulungsangebote für Diabetiker beim Diabetologen und auch in manchen Hausarztpraxen. Angehörige können an diesen Schulungen gerne teilnehmen. Einige Pharmafirmen bieten auch Broschüren über Diabetes und Ernährung an. Sicherlich findet man auch viele Angebote im Internet.
Marc Heßling:
Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Beitrag, Frau Landwehr. Sie unterstützen hiermit unseren Informationsauftrag unseren Klienten:innen gegenüber immens.
Zurück zum Pflegeratgeber.